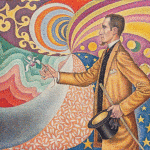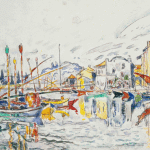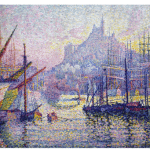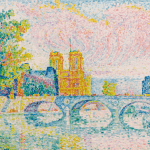Im Areal des Mühleramas in Tiefenbrunnen lädt nun ein Café Kornsilo zum Geniessen ein, wo früher Mme Carouge ihre schwarzen, trendigen Kleider verkauft hat – Mme Carouge, „der Kolkrabe“, wie ich einmal gelesen habe (NZZ vom 17.10.15). In der Matinee in Miller’s Studio sass dann La Lupa direkt vor mir, „der Papagei“, überaus farbig gekleidet wie immer und mit einem Käppchen auf dem orangefarbenen Haar, das Hardy Hepp wohl sehr gefallen hätte. Christa de Carouge hingegen war an diesem Sonntag nicht in Miller’s Studio. Wohl aber machte eine Amsel ihre Aufwartung – nämlich als Hauptfigur in Italo Calvinos Erzählung „Das Pfeifen der Amsel“ in dessen spätem Werk „Herr Palomar“. Mona Petri las diesen schönen, sehr präzisen Text in perfekter Diktion. „literatur und musik“ nennt sich die Reihe sonntäglicher Matineen, organisiert von der Tonhalle Zürich und dem Literaturhaus Zürich. Diesmal erklang zur Begleitung der Texte von Italo Calvino Musik von Luciano Berio, „Sequenza I“ beispielsweise für Flöte. Daniel Fueter lieferte blitzgescheite, wohl formulierte Einführungen zu Calvino und Berio und zur Wahlverwandtschaft von Berios Musik und Calvinos Literatur. Wahlverwandtschaften, so lautete früher der Titel dieser Matineen, die grossartige Verwandtschaften nachwies: Arthur Schnitzler und Gustav Mahler, Thomas Mann und Richard Strauss, William T. Vollmann und Dmitri Schostakovitsch oder dann Franz Schubert und Elfriede Jelinek.
Calvino untersucht sehr differenziert den Gesang der Amsel; er fragt sich, ob zwei Amseln einen Dialog führen oder einfach nur so vor sich her singen würden, ob die Bedeutung ihres Gesanges in den Tönen oder in den Pausen läge, ob es vielleicht für uns Menschen gescheiter wäre zu pfeifen anstatt zu reden – wirklich verstehen würden wir uns ja sowieso nie. Mir erging es mit Fueters Ausführungen ziemlich ähnlich: Habe ich sie wirklich verstanden? Wieso denn kann ich sie jetzt kaum mehr rekonstruieren? Könnte ich ein Amsellied singen? Oder Passagen aus einer der Sequenzen Berios? Nebst der Flöte hörten wir, jeweils immer solo, eine Harfe, eine Klarinette und ein Cello. Keine noch so kurze Sequenz aus einer dieser „Sequenze“ ist mir im Gedächtnis haften geblieben. Eine für mich sehr schwierige Musik! Aber das macht für mich den grössten Reiz dieser Matineen aus: Ich lerne Texte kennen und höre Musik, der ich mich sonst nie aussetzen würde – grossartige Sonntagvormittage, auch wenn ich das Dargebotene oft als schwierig empfinde.
Am frühen Nachmittag nach der Vorstellung gaben die Wolken grosse Stücke Himmels frei, und man sah die blasse Mondscheibe. Es war, als würde der Himmel Calvinos letzten vorgetragenen Text „Der Mond am Nachmittag“ illustrieren wollen.