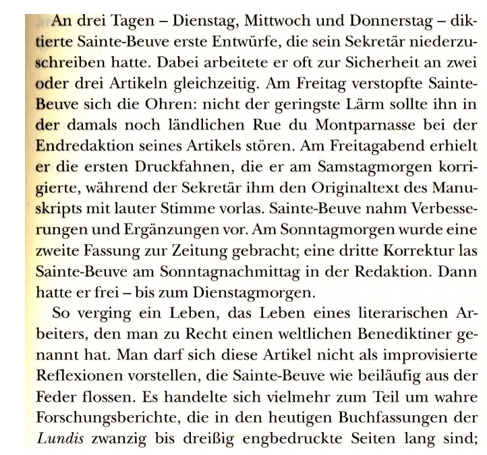Die Versuchung war zu gross! Trotz Corona und trotz der steigenden Fallzahlen diesen Herbst wagten wir uns – zunächst mit gemischten Gefühlen – ins Theater Rigiblick. Es erwartete uns ein Balladenabend mit Franz Hohler. Seine Celloballaden aus den Siebziger- und Achtzigerjahren sind uns in bester Erinnerung und so konnten wir nicht widerstehen. Vieles andere haben wir abgesagt, Freunde ausgeladen, Konzerte nicht besucht, aber «Friedrich den Gerechten» wollten wir uns nicht entgehen lassen. Der Abend hielt, was er versprach.
Hohlers Texte sind erstaunlich aktuell, so etwa, wenn er im Nachgang zur Publikation des Club of Rome (1972) konstatiert, dass der Weltuntergang bereits begonnen hat: Ein Käfer stirbt aus, und die Nahrungskette bricht auseinander, die Meere steigen, die Ressourcen werden immer knapper, und mir fällt Einstein ein, der einmal sagte, der dritte Weltkrieg werde als Atomkrieg fürchterlich sein, und den vierten würden die Menschen wieder mit Pfeilen und Keulen bestreiten.
Nur in hübschen Details wird das Alter der Lieder sichtbar. Die «Ballade vom Computer PX» beschreibt, wie ein Rechner zu flirten und balzen beginnt, wie die Technikerin zunächst erschrickt, sich aber schliesslich in die Maschine verliebt. «Sie schürzt ihre Röcke», heisst es, und kriecht in die Maschine hinein und man hört ein nächtelanges, behagliches Brummen. Die Schöne aber sieht man nie wieder.
Einmal mehr beeindruckte mich das Ende der Ballade vom gerechten Fritz:
Er beschloss nun nirgendwo zu bleiben, sich keiner Macht mehr zu verdingen, und hüpft seither in langen Sprüngen, damit er nicht am Boden schuldig werde, nackt auf den Grenzen unsrer Erde von Niemandsland zu Niemandsland. Er nimmt kein Geld mehr in die Hand, er isst nicht mehr, er trinkt nicht mehr und spricht auch nicht dabei.Er ist frei. Das war die Geschichte von Friedrich, dem Gerechten, das war die Geschichte vom gerechten Fritz. Versucht sie zu verstehen und den Friedrich nicht zu ächten, denn das Schicksal dieses Menschen ist kein Witz. Wenn ihr ihn trefft, behandelt ihn mit Schonung und offeriert ihm doch ein Bett in eurer Wohnung. Er wird nicht kommen, weil die Gänse, die die Daunenfedern gaben, sich auf Kosten eines Hungerkindes vollgefressen haben, darum legt euch selber in das Bett und ich hoff, ihr träumt recht nett von Friedrich, dem Gerechten, ja von dem, ich finde, dieser Mann verdient Respekt, denn die Moral ist für uns Ungerechte sehr bequem: Wer gerecht sein will, verreckt.
In unserer Zeit, wo die Politik mehr und mehr moralisiert wird, wo «Gerechte» missionarisch ihre «Wahrheiten» verkünden und alle und alles andere verachten, ist diese Ballade hörenswert.
Dann war da noch «Dr Dienschtverweigerer», Hohlers Übersetzung des Chansons von Boris Vian, der es zur Zeit des Algerienkriegs geschrieben und gesungen hat. Hohler produzierte es 1983 für eine seiner «Denkpausen». Doch obschon er den Schluss stark abgemildert hatte, wurde das Lied nicht ausgestrahlt, worauf Hohler die «Denkpausen» einstellte.
Herr Oberschtdivisionär
Dir gseht, das i nech schrybe
Chönnt s Läsen au lo blybe
Dir heits jo süsch scho schwär
I danken euch für d Charte
Dir wüsset, die vo wäge
Und hanech welle säge
Dir chönnet uf mi warte
Herr Oberschtdivisionär
I wirde nid Soldat
Vollbring ke Heldetat
I eusem Militär
… … … …
I glaub, jetz wüsster gnue
Und die, wo mi wei foh
Die sellen ynecho
I bschliesse d Tür nid zue.
Das Schweizervolk stimmte erst 1992 dem Zivilschutzgesetz zu! Ich habe mir nach dem Theaterabend zuhause «Le Déserteur» von Boris Vian angehört. Das Original ist ebenso eindrücklich wie Hohlers Mundartfassung. Erstaunlich ist allerdings, wie schleppend langsam Vian 1954 sein Chanson vorträgt. Es ist wie mit alten Filmen: Diese langen Einstellungen! Man hat Zeit zu hören, zu sehen und zu verstehen.